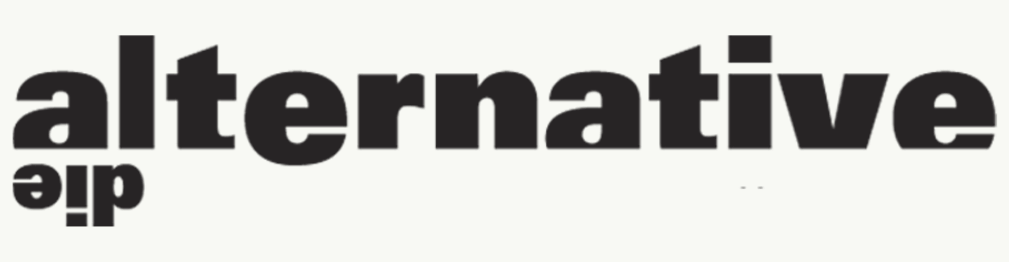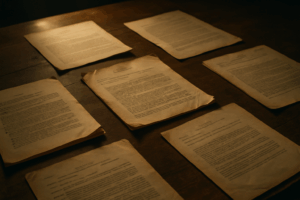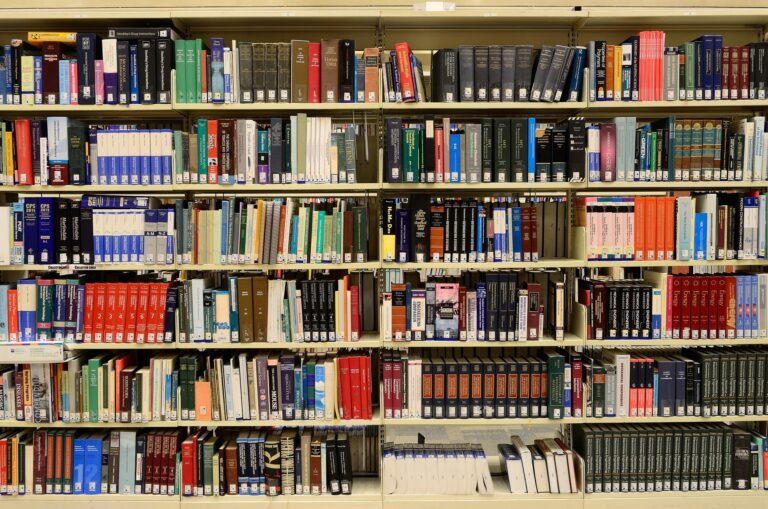Das langsame Ausdünnen
Das Regierungsprogramm versprach Stabilität – die Budgetrede des Finanzministers hat nun mit aller Deutlichkeit geliefert, was das in der Praxis bedeutet: ein hartes Sanierungspaket, das tief in die Struktur des Sozialstaats eingreift und dessen Lasten ungleich verteilt. Berichten zufolge beläuft sich das Konsolidierungsvolumen auf 6,4 Mrd. Euro für 2025 und 8,7 Mrd. im Jahr 2026. Was technisch als „Budgetkonsolidierung“ bezeichnet wird, bringt im Alltag viele spürbare Veränderungen. Vor allem dort, wo Menschen ohnehin wenig Puffer haben: bei den Familienleistungen, in der Pension und bei den täglichen Kosten.
Treffsicher, aber nicht für alle
Das enorme Sanierungsvolumen von 6,4 Mrd. Euro im Jahr 2025 (und 8,7 Mrd. 2026) wird zu rund zwei Dritteln durch Ausgabenkürzungen erreicht. Das betrifft vor allem Leistungen, auf die viele angewiesen sind:
Der Klimabonus, bislang eine universelle Ausgleichsmaßnahme für die CO₂-Bepreisung, wird in seiner bisherigen Form abgeschafft. Stattdessen wird der Pendlereuro ab der Veranlagung für das Jahr 2026 von zwei Euro auf sechs Euro pro Kilometer verdreifacht. Dies ist eine klare politische Entscheidung: Weg von einer allgemeinen Entlastung für alle, hin zu einer gezielten Förderung von Erwerbstätigen mit Arbeitsweg .
Auch bei den Familienleistungen wird der Sparstift angesetzt. Die jährliche automatische Anpassung wichtiger Familien- und Sozialleistungen an die Inflation (Valorisierung) wird für die Jahre 2026 und 2027 ausgesetzt. Diese Nicht-Valorisierung ist eine reale Kürzung, die den Wert der Unterstützung für Familien Jahr für Jahr schmälern wird.
Mehr Jahre, weniger Planbarkeit
Deutliche Verschärfungen wurden im Pensionssystem beschlossen. Die Regierung hebt das faktische Pensionsantrittsalter durch konkrete Maßnahmen an:
- Das Antrittsalter für die Korridorpension wird schrittweise vom vollendeten 62. auf das vollendete 63. Lebensjahr angehoben.
- Die dafür notwendige Anzahl an Versicherungsmonaten steigt von 480 auf 504 Monate.
- Die erstmalige Pensionsanpassung für Neupensionist:innen wird auf pauschal 50 % des Anpassungsfaktorsfestgelegt, was für viele eine reale Kürzung im Vergleich zur bisherigen Regelung bedeutet.
Das klingt nach langfristiger Stabilisierung, bedeutet aber für die heute Arbeitenden: weniger Planbarkeit und die Notwendigkeit, länger zu arbeiten. Die Gebühr für die E-Card wird von 10 auf 25 Euro erhöht, wobei die bisherige Befreiung für Pensionist:innen mit Ablauf des Jahres 2026 endet.
Der Arbeitsmarkt: Eine Leerstelle im Budget
Ein zentraler Kritikpunkt bleibt unangetastet: die Realität älterer Arbeitnehmer:innen. Viele gehen heute nicht aus einem aktiven Job in Pension, sondern aus dem Krankenstand oder nach langer Arbeitslosigkeit. Die budgetären Maßnahmen greifen hier nicht ein – sie verschieben nur das Problem, indem sie den Zugang zur Pension erschweren. Eine langfristige Lösung für einen altersgerechten Arbeitsmarkt fehlt weiterhin. Ebenso findet eine ernsthafte Debatte über Arbeitszeitverkürzung als Mittel zur Entlastung und gerechteren Verteilung von Arbeit im Budget nicht statt.
Sozialstaat im Wandel: Wo das Geld geholt wird
Während bei den Bürger:innen gespart wird, bleibt eine strukturelle Reform bei der Besteuerung von Vermögen aus. Statt einer Vermögens- oder Erbschaftssteuer gibt es einige wenige Maßnahmen um Einnahmen zu erhöhen:
- Die Bankenabgabe (Stabilitätsabgabe) wird so angepasst, dass sie 350 Mio. Euro pro Jahr zusätzlich bringt.
- Der Energiekrisenbeitrag für fossile Energieträger wird für die Zeiträume ab April 2025 von 40 % auf 50 % der Bemessungsgrundlage erhöht.
- Bei der Veräußerung von Grundstücken nach einer wertsteigernden Umwidmung wird künftig ein Umwidmungszuschlag von 30 % auf den Gewinn eingehoben.
- Die Stiftungseingangssteuer auf Zuwendungen an Privatstiftungen wird von 2,5 % auf 3,5 % erhöht.
- Die Konzessionsabgabe für Elektronische Lotterien wird von 40 % auf 45 % angehoben.
Ein klarer Kurs
Das Budgetbegleitgesetz 2025 baut den Sozialstaat nicht heimlich ab – es baut ihn offen um. Universelle Leistungen werden zurückgefahren und durch an Bedingungen geknüpfte Förderungen ersetzt. Die Solidarität wird einer Logik der ökonomischen Nützlichkeit untergeordnet. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen mit der Teuerung kämpfen, ist das ein gefährlicher Kurs. Was wir erleben, ist kein „leiser Rückzug“, sondern ein harter Schnitt – und zwar auf Kosten der breiten Bevölkerung und zukünftiger Generationen.