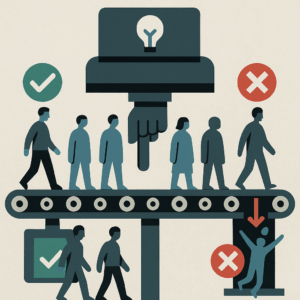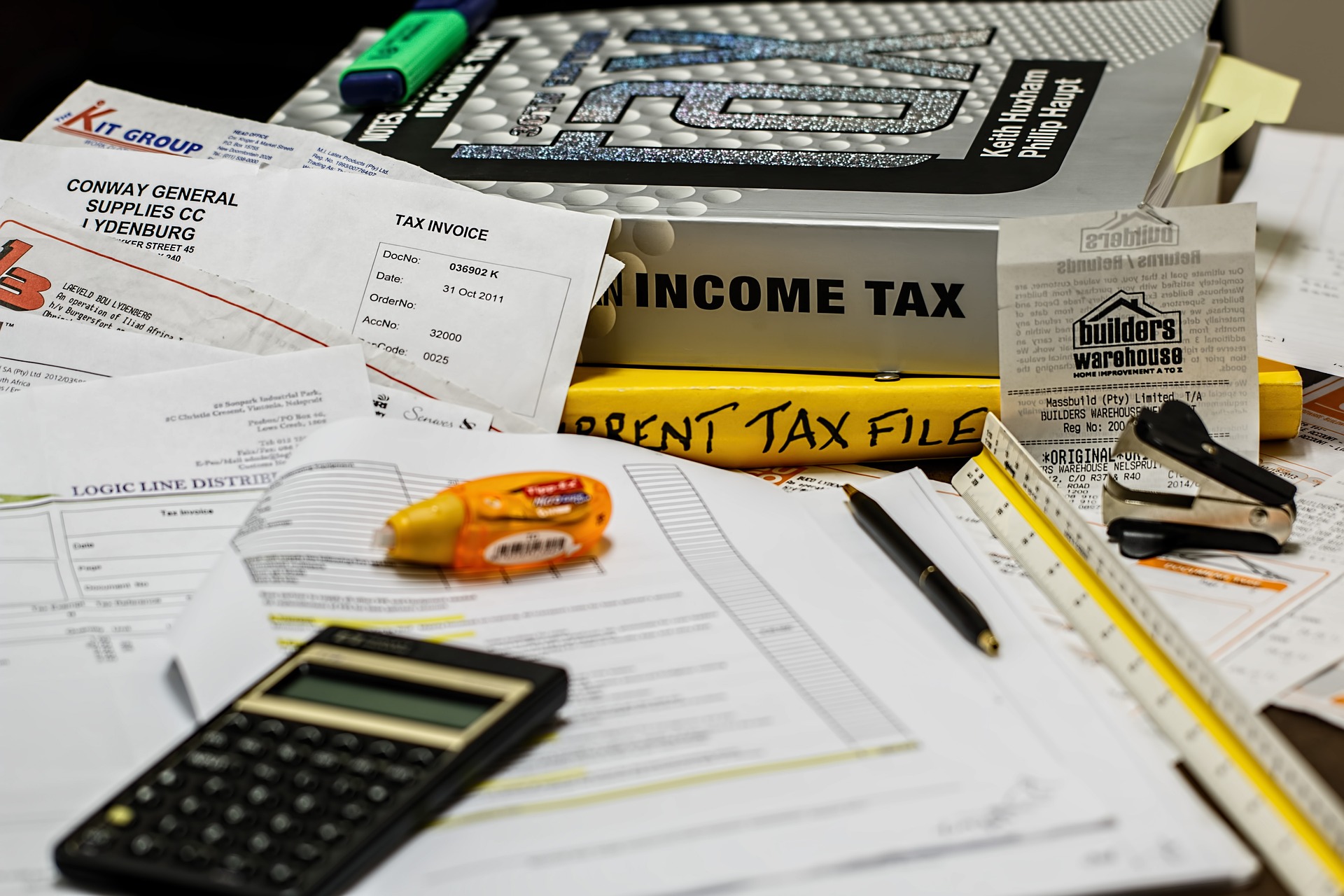Der Wirtschaft geht es schlecht Hören wir. Die hohen Lohnkosten sind schuld, wird uns erklärt.
Ein seltsame Schieflage ergibt sich bei den letzten Krisen- und Insolvenzmeldungen, sei es VW in Deutschland oder KTM in Österreich. Der Auszahlung von hohen Boni und Ausschüttungen an die Aktionär:innen folgen ein Zahlungsstopp an die Beschäftigten, Insolvenzmeldungen, Werksschließungen und Personalabbau. Bei KTM kommt dazu, dass Corona-Hilfen in Millionenhilfe beansprucht wurden, denen millionenschwere Dividenden an den Hauptaktionär Pierer seit 2020 gegenüberstehen. Der Blog Kontraste sieht hier einen beinahe direkten Zusammenhang.
Privatisierung von Gewinnen
Dass Ausschüttungen an Aktionär:innen in Zeiten vermutlich absehbarer wirtschaftlicher Probleme auch schwere Folgen für die Unternehmen haben, liegt auf der Hand. Damit wird den Unternehmen Kapital entzogen, welches investiert werden könnte. Oder eingesetzt werden kann, um die Folgen von falschen Einschätzungen des Managements unternehmensintern abzufedern. Hier kommt die Frage auf, ob es nicht gesetzliche Nachschärfungen bräuchte. Denn die Idee, öffentliche Förderungen und Krisenhilfen unter Umständen mit Gewinnen gegenzurechnen, erscheint anlässlich dieser Entwicklungen keineswegs absurd.
Vergesellschaftung der Verluste
Durch Stellenabbau und Insolvenz, Werksschließungen und Produktionsstopp werden die Folgen der beschriebenen Unternehmenspolitik auf die Allgemeinheit abgewälzt. Ganz abgesehen von der schwierigen Situation, in der sich die Beschäftigten befinden, ihre Ansprüche werden aus öffentlichen Geldern – unter anderem als Teil der Lohnnebenkosten – gedeckt. Auch Umschulungen und Arbeitslosengeld zahlen alle Lohnabhängigen über ihre Beiträge. Das ist ein vernünftiges Solidaritätsprinzip, doch scheinen sich die Unternehmen zunehmend daraus zu verabschieden. Damit wandert das unternehmerische Risiko zumindest teilweise zu den Lohnabhängigen, die keine Entscheidungsmacht in diesen Fragen besitzen.
Aber Hauptsache wenig Staat
Die stetige Forderung nach Senkung der Lohnnebenkosten und „weniger Staat, mehr Privat“ der wirtschaftsliberalen und konservativen Flügel sowie von Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung wirken entlang dieser Entwicklungen beinahe zynisch. Denn wenn es um öffentliche Förderungen geht, dann ist der Ruf nach dem Staat laut. Ebenso bei der Bewältigung von Fehlentscheidungen im Management und in der Unternehmensstrategie. Gleichzeitig werden Steuern und eine Beteiligung am öffentlichen Wohlstand eher als Zumutung aufgefasst. Es scheint ein Sport zu sein, so viel wie möglich für sich selbst herauszuholen. Ein Sport, bei dem nur Wenige mitmachen können. Denn jene, die wirklich Unterstützung brauchen, werden für ihre Bedürftigkeit beschimpft und verurteilt.
Und schon gar keine Vermögenssteuern
Bei den laufenden Koalitionsverhandlungen wird erneut deutlich, dass dieser Entwicklung kaum entgegengetreten wird. Die reflexartige Ablehnung von Vermögens- und Erbschaftssteuern, die mantraartige Forderung nach der Senkung von Lohnnebenkosten gedeiht in einem Erklärungsumfeld, in dem sogenannte Expert:innen die Insolvenzen hauptsächlich mit zu hohen Lohnkosten begründen. Hinterfragt wird diese Argumentation selten. Aber das macht sie nicht automatisch richtiger.