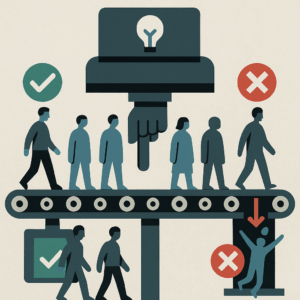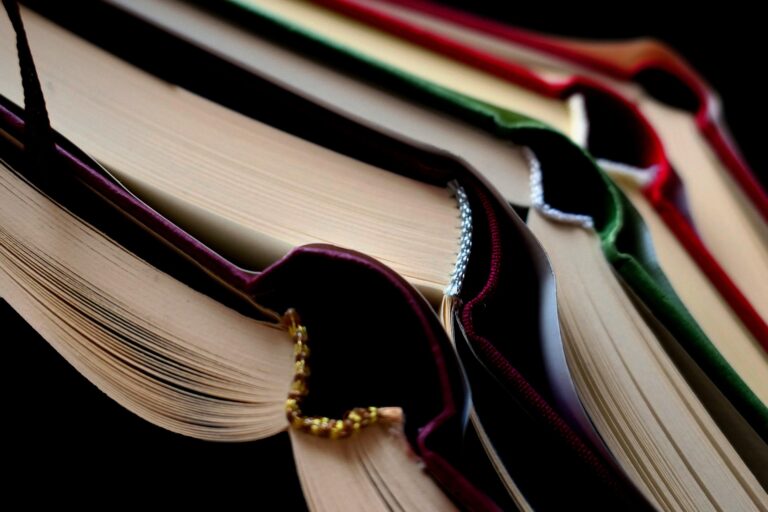Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Diese viel bemühte Phrase ist gleichermaßen zutreffend wie irreführend. Denn hinter einem Kompromiss können sich sehr ungleiche Machtverhältnisse verbergen. Amazon ist mittlerweile schon legendär für seine schlechten Arbeitsbedingungen und den offenen Kampf gegen gewerkschaftliche Organisierung in den USA. Wenn der Konzern also kleine Zugeständnisse macht und gewerkschaftliche Aktivist:innen diesem trotz ihrer viel weiter reichenden Forderungen zustimmen, dann ist das ein Kompromiss. Beide Seiten haben sich bewegt, allerdings auf einer extrem schiefen Ebene. Objektiv gesehen ist das noch weit von einem fairen Arbeitsverhältnis entfernt.
Wenn in einer gewerkschaftlich gut organisierten Branche in Österreich ein fairer KV-Abschluss zustande kommt, dann mag das ein objektiv besserer Kompromiss sein. Aber auch hier wird dahinterstehende Realität etwas verschleiert. Der Abschluss kommt nicht deshalb zustande, weil die Arbeitnehmer:innenseite die Arbeitgeber:innenseite mit überzeugenden Argumenten gewinnen kann, sondern weil sie eben gut organisiert ist. Das heißt, sie schöpft aus der Solidarität der Beschäftigten Macht. Und hätte die österreichische Arbeitnehmer:innenseite diese Macht nicht, könnten die Situation deutlich näher bei der US-Realität liegen.
Noch krasser wird die Thematik, wenn man das Feld der internationalen Politik betrachtet. Die Trump-Regierung drängt Russland zu einer Kompromisslösung, um den Krieg zu beenden. Ob das funktioniert, ist unklar. Was wir aber wissen ist, dass im asymmetrischen Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine ein Kompromiss nur deshalb zur Diskussion steht, weil andere Staaten mit der Ukraine solidarisch waren. Ohne westliche Unterstützung würde das Land als souveräner Staat nicht mehr existieren. Bei einem enormen Machtungleichgewicht steht an Stelle des Kompromisses die vollständige Durchsetzung der Interessen einer Seite. Das gilt beispielsweise für die Kinderarbeit in britischen Kohleminen während der frühen Industrialisierung vor 200 Jahren. Ohne Gegenmacht, kein Kompromiss.
Argumente sind nicht bedeutungslos und können, bei entsprechender Wirkung auf die Öffentlichkeit, einen entscheidenden Unterschied machen. Aber selbst die Verbreitung von Argumenten hat wieder viel mit Macht zu tun. Wer besitzt Zeitungen oder Fernsehstationen? Wer besitzt die großen Social Media Plattformen? Wer bestimmt über die Themenlage im ORF? Macht ist nicht alles, das wäre zynisch. Aber die Rolle der Macht zu leugnen, wäre wiederum naivDie Gewerkschaftsbewegung weiß seit bald 200 Jahren, dass ihre Argumente umso stärker durchschlagen, umso mächtiger sie ist. Und die Macht von Leuten, die eigentlich keine Macht haben, speist sich damals wie heute aus derselben Quelle: Solidarische Organisierung.